Aus über 40 landwirtschaftlichen Betrieben, die sich für das Projekt „FuLaWi“ meldeten, wurden acht sehr unterschiedliche Betriebe für die Anlage von Versuchsflächen ausgewählt. Die Agroforstsysteme unterscheiden sich hinsichtlich Flächengröße (1 bis knapp 7 ha), Standorteigenschaften, Zertifizierung (6 ha bio, 2 ha konventionell), Flächenstatus, Tierart, Herdengröße (30 ha bis 480 ha), Produktionsziel und Flächenstatus (Dauergrünland und Acker). Die Anlage auf Grünland muss sehr schonend durchgeführt werden, um die Grasnarbe zu erhalten. Die auf den Flächen verteilten Gehölzareale umfassen 0,15 bis 0,9 ha Fläche. Dort wurden zehn verschiedene Pappel- und drei Weidenzüchtungen etabliert. Zusätzlich wurden zehn weitere vielversprechende Gehölzarten wie Maulbeere und Hasel gepflanzt. Je nach Betriebswunsch wurden eng stehende Gehölze als Futterlaubhecke vorzüglich für die direkte Beweidung oder auch Kopfbäume in weiterem Abstand für die Ernte durch Schnitt für Futter und holzige Biomasse gepflanzt.
Pflanzung und Pflege
Die Etablierung der Futterlaubsysteme erfolgte mit im Agroforst-Sektor bewährtem Pflanzgut, Maschinen und Methoden. Zuerst wurden die Pflanzstreifen ausgemessen und ein feinkrumiges Saatbeet (z.B. mit Bodenfräse, Scheibenegge, Gruber) erzeugt. Auf Dauergrünland wurde hier nur mit geringen Bearbeitungstiefen und schmalen Pflanzstreifen gearbeitet. Gepflanzt wurde mit einer am betriebseigenen Traktor angehängten Spezialmaschine. Die 90 cm langen, bewurzelten oder unbewurzelten Pflanzruten wurden ca. 60 cm tief gesetzt und leicht rückverdichtet. Die Pflanzung dauerte auf keinem Betrieb länger als einen Tag. Wo es nötig war wurde ein mobiler Weidezaun zum Schutz vor Verbiss aufgestellt. Bis in den Spätsommer hinein wurde der Nahbereich der Bäume „schwarz“ gehalten, also das Beikraut entfernt. Je nach Betriebsausstattung wurden dafür verschiedene Maschinen und Methoden angewandt, u.a. Grubber, Eggen, Hacken, Fräsen und auch handgeführte Zweiachser mit Fräse. Je nach Beikrautdruck und Höhe der Bäume musste vereinzelt auch zur Handhacke gegriffen werden. Eine Bewässerung wurde nur bei bewurzeltem Pflanzgut nach längerer Trockenphase nötig. Die Etablierungsraten aller acht Anlagen lagen dank guter Pflege und eines feuchten Jahres bei 90 % und darüber. Die Zuwachsraten hingen stark vom Pflanzzeitpunkt, der Sortenwahl sowie den Standorteigenschaften ab. Auf einigen Flächen konnten Triebhöhen von zwei bis drei Metern im Herbst gemessen werden, auf anderen nur rund ein Meter. Im zweiten Standjahr sollen im Frühsommer die Futterhecken das erste Mal direkt beweidet werden. Danach erfolgt ein Rückschnitt, sodass junge Triebe vital austreiben und für das Beweiden weiter zugänglich sind. Bei den Kopfbäumen erfolgt der erste Erziehungsschnitt voraussichtlich im Sommer. Der erste Schnitt sollte erst erfolgen, nachdem der Baum sicher etabliert ist.
Zwei Tonnen pro Hektar
Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine eng gepflanzte Pappelanlage ca. zwei Tonnen Blatt-Trockenmasse pro Hektar und Jahr produzieren kann. Die Produktivität von Kopfbaumsystemen muss noch untersucht werden. Ein Hektar Gehölzfläche ergibt eine etwa fünf bis zehn Hektar große Agrofrostfläche.
Kleinere Systeme mit wenigen hundert Bäumen können auch in Eigenleistung mit einem Tiefenmeißel oder Erdbohrer gepflanzt werden. Unabhängig von der Größe, hängt der Erfolg einer Anpflanzung stark von einer sachgerechten Bodenvorbereitung und intensiven Beikrautregulierung im Etablierungsjahr ab. In Deutschland und Österreich sind Agroforstsysteme auf Ackerland, Dauerkulturen und Dauergrünland im Rahmen der GAP prämienberechtigt. Die Gehölze in Agroforstsystemen dürfen genutzt und bei Bedarf wieder entfernt werden. Der Ackerstatus ändert sich dadurch nicht. Je nach Land und Bundesland gibt es zudem weitere Förderungen über die 2. Säule bis zu investiven Förderungen. Dies und auch die nationalen Anforderungen sollten vor der Umsetzung geprüft werden. Agroforstsysteme können für Pflanzenbau, Tierhaltung, den Gesamtbetrieb und letztlich ganze Landschaften vielfältige Vorteile haben. Kleine Wiederkäuer können z.B. direkt durch Schutz vor Wetterextremen und zusätzlichen Schatten profitieren. Gehölze können als Beschäftigungsmaterial und zusätzliche Futtergrundlage dienen, welche vor allem in Dürrephasen länger verfügbar sind. Gleichzeitig können vom verbesserten Mikroklima auch umliegende Acker- oder Grünlandflächen profitieren. Diese Effekte werden in dem Projekt ebenfalls untersucht. Beobachtungen zeigen, dass sich die Tiere im Sommer gerne im Schatten der Gehölze aufhalten und diese gezielt beweiden, bis keine Blätter mehr erreichbar sind.
Fotos, Tabellen zu den Kosten einer Anlage und eigene Artikel zu Futterwert und Verdaulichkeit von Futterlaub finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe! Hier gratis Probeheft oder Abo bestellen!
Weitere Artikel aus
LANDWIRT AT /


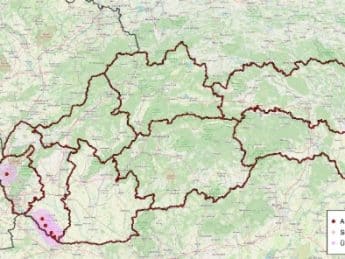
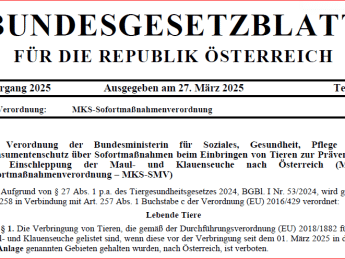
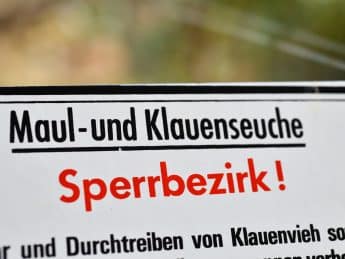

Kommentare